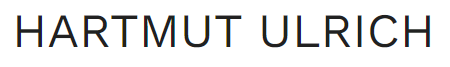Eintagesrennen, Ultracycling, Bikepacking
Was ist Unsupported Ultracycling?
Eintages- oder Etappenrennen? Gran Fondo oder Gravelrennen? Supported oder unsupported? Fixed Route oder lediglich Checkpoints? Zeitnahme oder nicht? Utracycling oder Bikepacking? Die Variationsbreite möglicher Herausforderungen auf dem Fahrrad ist schier unbegrenzt, und jährlich kommen neue kreative Formate hinzu. Ein paar Gedanken zur Einordnung.

Der Gran Fondo als Eintagesrennen: Extrem fordernd - aber kein Ultracycling
Der
Ötztaler Radmarathon gilt als eins der härtesten Radrennen für Amateure weltweit (hier meine Teilnahme aus dem Juli 2023). Der Ötzi ist ein Gran Fondo, ein Langstrecken-Eintagesrennen, das auf asphaltierten Straßen ausgetragen wird. Der Begriff stammt aus Italien, entstand um 1970 und richtet sich an Amateure (auch wenn bei den großen Gan Fondos zunehmend Ex-Radprofis die Spitze dominieren). Gran Fondo deutet "große Fahrt" und beschreibt Radsportwettbewerbe oberhalb von 100 Kilometern Distanz und mindestens 2.000 Höhenmetern.
Ein weiteres Merkmal für einen Gran Fondo ist die Zeitnahme: Er wird als sog. Jedermann-Rennen gefahren (alle dürfen teilnehmen), und am Ende gibt es ein Ranking und Ergebnislisten, häufig nach Alterklassen aufgeteilt. Der Gran Fondo startet im Massenstart (meistens in mehreren Starterblocks, um auch großen Teilnehmerzahlen einen geordneten und fairen Start zu ermöglichen). Auf der Strecke sind Verpflegungsstationen eingerichtet. Ein Gran Fondo ist also "supported".
Die entscheidenden Faktoren beim Ötztaler, dem legendären Eintages-Gran Fondo mit seinen vier Bergpässen über 227 Kilometer und 5.500 Höhenmeter sind ein herausragendes Kraft-Gewichts-Verhältnis und eine gute Sauerstoffaufnahmekapazität (beides lässt sich trainieren, wird aber vor allem durch die Gene beeinflusst, gemeinhin als "Talent" bezeichnet), richtige Ernährung, kluge Renneinteilung sowie mentale Stärke. Der Ötztaler findet auf komplett gesperrten und durchgehend asphaltierten Straßen statt, es gibt feste Labestationen, Stopps lassen sich verlässlich planen, und nach 7,5-14 Stunden ist alles vorbei. Extrem fordernd durch die langen Anstiege und die sehr schnellen Abfahrten – aber kein Ultracycling. Auch die
ISTRIA300 (hier meine Geschichten aus drei verschiedenen Jahren) über 300 Kilometer und 5.300 Höhenmeter rund um die istrische Halbinsel ist ein Eintagesrennen und ein Gran Fondo.
Radtouristikfahrten (RTF)
Hat eine organisierte Ausfahrt vergleichbare Distanzen und Herausforderungen wie ein Gran Fondo, jedoch keine offizielle Zeitnahme, handelt es sich um einen sog. RTF, eine Radtouristikfahrt. RTFs sind ebenfalls Jedermann-Veranstaltungen, sie können supported oder unsupported ausgetragen werden, auf Asphalt oder Gravel. Meist finden RTFs auch auf ungesperrten Straßen statt, die Teilnehmer müssen sich also immer an die Verkehrsregeln halten - zum Beispiel an roten Ampeln warten - was ein echtes Rennen verzerren würde. Veranstalter entscheiden sich häufig für dieses Format, um die strengen Sicherheitsauflagen für Gran Fondos und Radrennen umgehen zu können. RTFs öffnen sich auch für mehr Leistungsklassen, die Distanzen sind häufig kürzer und es gibt auch Starterlaubnis für Pedelecs und E-Bikes.

Badlands (2022): Gravel, unsupported, nicht an einem Tag zu fahren (780 km), wird an der Spitze ganz ohne Schlaf gefinisht, weiter hinten nicht: Ultracycling.
Bikepacking
Bikepacking ist keine organisierte Veranstaltung, sondern eine Variante des Radreisens, also über mehrere Tage mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Der Unterschied zum Radreisen besteht meistens darin, dass Bikepacking sportlicher gefahren wird als Radreisen. Die kleinste Variante ist der sog. Overnighter, der sich hervorragend für spontane Wochenend-Touren eignet. Je nach Anspruch und Erfahrung biwakieren Bikepacker einfach irgendwo im Freien (was in Deutschland zum Beispiel nicht ohne weiteres erlaubt ist) oder checken spontan vor Ort in Herbergen oder Hotels ein.
Eine Veranstaltung wie der
Tuscany Trail (hier meine Teilnahme 2024) ist ein Hybrid aus RTF und Bikepacking: Die wunderschöne Toskana-Runde führt über rund 465 Kilometer, die Route ist fix, es gibt aber keinen organisierten Massenstart, keine Zeitnahme, keine Verpflegungsstationen und auch kein abschließendes Ranking. Teilnehmen können Fahrerinnen alle Alters- und Leistungsklassen.
Ultracycling
Was also ist Ultracycling? Grundsätzlich ist Ultracycling Bikepacking, man hat Ausrüstung für mehrere Tage am Rad). Ultracycling hat aber immer den Charakter eines Rennens, es kann auf Asphalt stattfinden oder auf Gravel, meistens handelt es sich um einen Mix. Ultracycling beginnt oberhalb von Distanzen, bei denen die Frage nach Schlafpausen entsteht. Sonderlich exakt ist diese Definition nicht, denn zahlreiche sehr lange Rennen werden an der Spitze komplett ohne Schlafpausen gefahren. Schlafpausen werden aber meistens verwendet, um Ultracycling zu erklären. Ein gutes Beispiel ist das Gravelrennen The Traka (hier mein Fahrbericht zum Traka360) in Girona: Die Varianten bis 360 Kilometer absolvieren die Teilnehmerinnen nur mit kurzen Verpflegungsstopps. Schlafpausen sind weder nötig noch sinnvoll, auch wenn 360 Gravel-Kilometer an einem Tag extrem und durchaus nichts für Anfänger sind. Das Traka folgt fixen Routen und ist supported, so kommen die Teilnehmer mit überschaubaren Mengen Wasser und Essen am Rad aus und haben keinerlei Planungs-Unsicherheiten.
Das Gravelrennen
Badlands über 780 Kilometer und 17.000 Höhenmeter in den wüstenartigen Landschaften Andalusiens hingegen ist Ultracycling (hier meine Geschichte, noch unvollendet): Hier kommt die Leistungsspitze zwar ebenfalls komplett ohne Schlaf ins Ziel (die Besten finishen die 780 Kilometer unter 40 Stunden). Für die Mehrzahl der Teilnehmerinnen werden Schlafpausen aber unverzichtbar, sie liegen zwischen 1,5 und 6 Stunden pro Tag, mitunter auch als Zwangspausen, wenn in der Mittagshitze die Temperaturen deutlich über 40 Grad ansteigen. Badlands ist komplett unsupported, Verpflegung, Pannenmanagement und alle Entscheidungen über die Renneinteilung liegt allein bei den Startern, Hilfe von außen ist nicht erlaubt. Lediglich eine fixe Route ist vorgegeben, um eine direkte Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Vielleicht ist das die bessere Definition: Beim Ultracycling wird die Summe aller Zeiten mitentscheidend für das mögliche Endergebnis, die die Teilnehmer nicht im Sattel verbringen. Dazu gehöhren Gehpassagen, Einkaufszeiten, Essensstops, Reparaturstopps, Navigationsfehler und daraus resultierende Umwege, Standzeiten, um sich umzuziehen und sich teilweise extremen Temperaturunterschieden anzupassen oder vor extremer Hitze zu schützen – und eben Schlafpausen. Die Summe dieser Standzeiten lässt sich auf Distanzen oberhalb von etwa 400 Kilometern nicht mehr allein durch schnelleres Fahren kompensieren - Stand- und Fahrzeiten müssen beim Ultracycling ganzheitlich mitgeplant und betrachtet werden.
Fahrtechnische Herausforderungen wie ein schneebedeckter oder stark verblockter Singletrail, oder kilometerlange Passagen mit losen Sand trennen beim Ultracycling die Spreu vom Weizen: Wer schieben und gehen muss, verliert auf solchen Abschnitten gegenüber den fahrtechnisch versierten Teilnehmern schnell zwei Stunden oder mehr. Beim
Atlas oder Silk Road Mountain Race (hier meine Geschichte zum Atlas Mountain Race 2025) schließlich wird selbst die Verpflegung zur Herausforderung: Leitungswasser ist nicht direkt trinkbar, Fleisch, Fisch und rohe Nahrung nur mit höchster Vorsicht zu genießen.
Ultracycling erfordert neben hervorragender körperlicher Fitness über viele Tage, kluger Renneinteilung, fahrtechnischem Können und mentaler Stärke zusätzlich noch solides Reparaturwissen, Improvisationsvermögen und viel Erfahrung mit körperlichen und mentalen Erschöpfungszuständen sowie extremen klimatischen Bedingungen. Letzten Endes geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen - einen angemessenen Mix aus Risiko und Vorsicht, aus Pacing und Pausenzeiten auszubalancieren. Das ist auch Erfahrungssache - sportliches Talent ist unverzichtbar, rückt aber gegenüber Gran Fondos deutlich in den Hintergrund.
Die Faszination des Ultracycling liegt in der Grenzerfahrung: Es geht darum, herauszufinden, wie viel Belastung das Individuum bewältigen kann und dabei die eigenen körperlichen und mentalen Grenzen zu überschreiten. Das ist zwar auch bei jedem Eintagesrennen möglich - aber sehr viel stärker fokussiert auf rein physische Aspekte als beim Ultracycling.
Die Teilnehmerinnen schätzen jenes brachiale Gefühl von Ausgesetztheit, unter extrem anspruchsvollen Bedingungen komplett auf sich selbst gestellt zu sein. Diese sehr besondere Variante des Radsports lebt vom wilden Freiheitsgefühl, einem sehr intensiven Gefühl von Lebendigkeit, das kein gewöhnlicher Tourist jemals so erleben wird.
Frauen sind übrigens zwar nach wie vor in der Unterzahl (auch bei Ultracycling-Rennen liegt die Frauenquote unter 15%). Sie haben aber eine deutlich höhere Finisher-Quote als ihre männlichen Mitstreiter – was vor allem daran liegt, dass sie vorsichtiger agieren und bessere Entscheidungen treffen - und natürlich auch daran, dass sich nur Frauen zu solchen Wettbewerben anmelden, die entsprechende Talente mitbringen.

Das Traka360 (hier 2024): 360 anspruchsvolle Gravelkilometer, jedoch relativ flach, supported und an einem Tag zu bewältigen - an der Grenze zum Ultracycling
Seltsame Nebenwirkungen
des Ultracycling
Weil Ultracycling Wettbewerb und Renngeschehen ist, gibt es auch sehr merkwürdige Standpunkte und allerhand Diskussionen um die Auslegung der Spielregeln und die Frage, was Vorteilsnahme ist. Weil die Rennen "unsupported" sind, ist die Annahme von jeglicher externer Hilfe verboten. Während die schnellen Fahrerinnen zum Beispiel beim Traka (das supported ist) eigene Verpflegungsstationen einrichten dürfen und zum Teil regelrechte "Boxenstopps" hinlegen, mit Kleidungs- und Ausrüstungswechsel, gleichzeitigem Flaschentausch und "Druckbetankung" mit Verpflegung (exakt, diese Stopps erinnern durchaus ein wenig an die Formel 1), sind solche Optimierungen bei Unsupported-Rennen verboten. Du musst deine Verpflegung entweder selbst mitschleppen oder unterwegs einkaufen, was beides Zeit kostet.
Dass es unfair wäre, Begleitfahrzeuge mit Verpflegung oder Ersatzteilen einzusetzen, liegt auf der Hand. Denn dann wären alle, die sich das leisten können, auf unfaire Weise im Vorteil - das Rennen würde unzulässig verzerrt, denn beim Ultracycling spielen die Zeiten eine mitentscheidende Rolle, die nicht im Sattel verbracht werden. Weird wird es allerdings im Fall von Pannen: Auch dann musst du dir selbst helfen. Regelkonform wäre es, z.B. in der nächstgelegenen Ortschaft mit einem Taxi zum nächtegelegenen Bikeshop zu fahren, fehlende Ersatzteile zu kaufen, mit dem Taxi zurück zu fahren, das Bike zu reparieren und das Rennen exakt an der Stelle weiterzufahren, an der du die fixe Route verlassen musstest. Aber was ist, wenn du dir im Bikeshop bei der Reparatur helfen lässt? Nicht erlaubt!
Unerlaubte externe Hilfe anzunehmen wäre es auch, einen anderen Rennteilnehmer z.B. um einen Ersatzschlauch zu bitten. Und genau da beginnen meine Bauchschmerzen: Die meisten Teilnehmer solcher Ultracycling-Events scheuen keine Mühen und Kosten, um überhaupt teilnehmen zu können. Die meisten sind bereits glücklich, wenn sie überhaupt im Limit finishen. In so einer Extremsituation von einem fehlenden Schlauch aus dem Rennen geworfen und zum Abbruch gezwungen zu werden, ist umso gemeiner, wenn währenddessen drei, vier Wettbewerber vorbeifahren, die vielleicht aushelfen könnten.
In so einer Situation würde ich natürlich helfen. Nicht nur, weil zwischen den Rennteilnehmern meist schon vor dem Start eine gemeinsame Verbindung entsteht, so wie sich viele Rennradfahrerinnen grüßen, wenn sie sich unterwegs begegnen. Man pflegt diese gemeinsame etwas irre Leidenschaft, das schweißt einfach zusammen. Ultracyclists sind einfach echte Charaktere. Man respektiert und man mag sich. Natürlich hilft man, das ist nur menschlich. Aber klar: Im unsupported Race einer anderen Fahrerin zu helfen, ist ein Regelverstoß. Wäre Hilfe von anderen Rennteilnehmern offiziell erlaubt oder sogar gewünscht, entstünde für alle der Druck, auch tatsächlich helfen zu müssen - was den eigenen Bestand an Ersatzteilen schmälern könnte, die dann vielleicht 100 Kilometer weiter selbst dringend benötigt würden - und im dümmsten Fall dann den Helfer aus dem Rennen kegeln würden. Weil jedes Gramm zählt, nimmt jeder nur das Allernötigste mit. Überzählige Gegenstände sind im Grunde genommen Planungsfehler.
Anekdote: Vor dem Start des Atlas Mountain Race kam über den Chat der Rennorga die Nachricht, das Gepäckstück eines Rennteilnehmers sei nicht angekommen, er stünde nun ohne jede Ausrüstung da, wer bitte aushelfen könne mit...und dann folgte eine Liste mit Gegenständen. Ich bin mir nicht sicher, ob der arme Kerl es tatsächlich an den Start geschafft hat (dass das Rad oder die Tasche nicht ankommt, war auch meine größte Angst; in Marrakesch gibt es aber einen recht großen Decathlon, in dem vermutlich ein Großteil der fehlenden Dinge zu beschaffen war). Denn auch vor dem Rennen ist das Equipment für jeden Teilnehmer bereits akribisch optimiert und auf das Nötigste reduziert - und eigentlich keine Teile übrig. Ist die Nachricht der Rennleitung dann nicht bereits ein Verstoß gegen die eigenen strengen Regeln?
NACH dem Rennen kam über den gleichen Kanal eine lange Nachricht über die Spielregeln. Und man möge doch nachträglich noch nicht regelkonforme Hilfe-Aktionen melden oder entsprechende Beobachtungen bei Dritten: Selbst wenn ich geholfen hätte (was ich nicht musste) oder etwas gesehen hätte: Ich hätte es nicht gesagt. Was in der Wüste passiert, bleibt in der Wüste. Denunziantentum und Petzen wegen einer lächerlichen Platzierung oder einer halben Stunde Zeitgutschrift in irgendeiner Tabelle hat nichts in diesem wundervollen Sport verloren, finde ich. Und wir haben noch keinen Pieps über Doping gesprochen: Über Mittel, die dich tagelang wach halten, über das Menschenmögliche hinaus, über Schmerzmittel, Aufputschmittel. Nein, ich weiß nichts Konkretes. Aber es ist naheliegend, dass diese Hilfsmittel auch im Ultracycling eingesetzt werden. Werden sie ja auch sonst bei jeder Form von Ausdauersport-Wettbewerben. Und unter Amateuren nachweislich deutlich massiver als unter Profis (weil es bei den Amateuren um ein schräges Bild des eigenen Ego geht). Also: Wenn ihr wirklich wirklich faire Wettbewerbe wollt, dann macht auch Dopingstichproben. Zum Beispiel unter den Top 10 Finishern.
Die strenge Auslegung des unsupported-Begriffs durch die Veranstalter ist ja auch deswegen etwas schräg, weil es um absolut nichts geht. Es gibt keine Preisgelder, keine Prämien, nichts. Nur Bilder und Kommunikation. Und die Stempel im Brevet-Heftchen sowie die abschließende Platzierung in einer Liste. Das war's. Ich kann verstehen, wenn an der Spitze, acht oder zehn Athleten bis aufs Messer um Minuten kämpfen (auch beim Ultracycling ist die Leistungsdichte an der Spitze enorm). Aber weiter hinten, wo es lediglich ums Ankommen geht und um Once-In-A-Lifetime-Erlebnisse?
Nur noch Kopfschütteln übrig habe ich schließlich, wenn Top-Athletinnen wie
Lael Wilcox dafür angegangen werden, dass sie ein Media-Team bei Events wie der Tour Divide haben, das Filmaufnahmen und Fotos macht und in Social Media-Kanäle postet. Wilcox lebt von ihren Ultracycling-Aktivitäten und Rekordfahrten, ist also tatsächlich Radprofi. Sie ist angewiesen auf Reichweite und Sichtbarkeit, wird aber dennoch von Neidern angegriffen. Die Media-Begleiter seien unzulässiger moralischer Support in schwierigen Phasen (Wilcox ist verheiratet mit ihrer Fotografin, die sie ständig begleitet). Also gut. Wer es hinbekommt, vom Ultracycling seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, fahrerisch zur Weltspitze gehört und auch die meisten Männer in solchen Rennen alt aussehen lässt, muss wohl wirklich mit Neid rechnen. Die nächsten Ultracycling-Wettbewerbe will Wilcox jedenfalls komplett ohne Begleitung fahren - einfach, um zu beweisen, dass sie dann auch gewinnt. Und weil sie von vorherigen Ausgaben der betreffenden Events bereits genügend Material hat.
Zu Ende diskutiert ist das alles nicht, zumal auch im Ultracycling eine gewisse Professionalisierung zu beobachten ist. Immer mehr Profis und Ex-Radprofis steigen ins Ultracycling ein, obwohl es da nichts zu verdienen gibt. Aber vielleicht ändert sich auch das bald - die ersten Veranstaltungen haben bereits Preisgelder angekündigt.
Ich wünsche mir, dass Ultracycling das bleibt, was es ist: eine faszinierende Grenzerfahrung, mit einer ganz eigenen Szene großartiger Charaktere aus aller Welt.

Hier ging mir nach 560 Kilometern der Akku der elektronischen Schaltung aus (natürlich hatte ich einen vollen Ersatzakku dabei). Hätte aber auch ein Platten sein können und mein letzter Ersatzschlauch. Oder verlorenes Werkzeug. Unsupported heißt: Hilfe von außen verboten. Hättest du trotzdem geholfen?